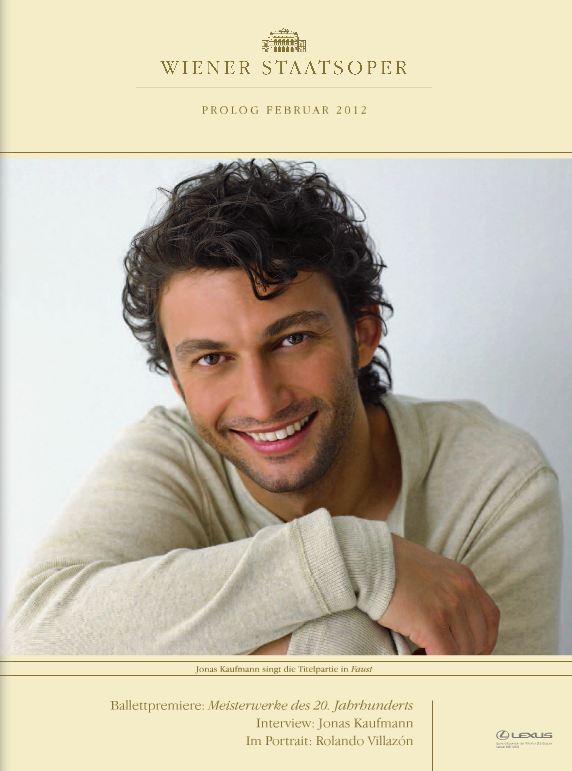 Wie
oft und wo haben Sie die Partie des Faust schon gesungen?
Wie
oft und wo haben Sie die Partie des Faust schon gesungen?
Jonas
Kaufmann: Bislang dreizehn Mal, davon sechs Mal in der Spielzeit
2004/2005 in Zürich, und im vergangenen Oktober/November sieben Mal an
der Met.
Wo liegen die Herauforderungen dieser Partie, wo die
Lieblingsstellen?
Jonas Kaufmann: Die besondere Herausforderung
liegt darin, dem alten, resignierten Faust stimmlich und darstellerisch
genauso gerecht zu werden wie dem jungen (oder besser: äußerlich
verjüngten) Faust, der aber eben nur in der Optik des jungen Liebhabers
erscheint; vom Kopf her kann er ja nicht jung sein, denn mit der
Verwandlung hat er ja nicht sein bisheriges Leben und den Pakt mit dem
Teufel vergessen. Er bleibt vom Wissen und Denken her der Alte und
erlebt, wovon so viele träumen: Mit der Erfahrung des reifen Menschen
noch einmal jung zu sein. Dass aus dem Traum ein Alptraum wird, dass
Faust Täter und Opfer zugleich wird – das glaubhaft darzustellen,
erfordert nicht nur schauspielerische Differenzierung, sondern auch
stimmliche Flexibilität. Und damit meine ich nicht nur das Ansteigen der
Tessitura, vom baritonalen Beginn bis zum hohen C in der Kavatine,
sondern die vielen verschiedenen Klangfarben. Das Dunkle, Brütende des
resignierten Mannes muss ja genauso in der Stimme zum Ausdruck kommen
wie die Lyrik in „Salut, demeure chaste et pure“ und die Leidenschaft im
Liebesduett. Die Partie ist von Anfang bis Ende so reich an Farben und
Nuancen, dass es mir wirklich schwer fällt, Ihnen jetzt meine
„Lieblingsstellen“ zu nennen.
Wo liegen für einen Sänger die
Qualitäten des französischen Repertoires?
Jonas Kaufmann: Ich
kann nur für das Tenorfach sprechen, und da bietet das französische
Repertoire überaus interessante und differenzierte Charaktere, die
musikalisch und darstellerisch eine besondere Wandlungsfähigkeit
erfordern. Denken Sie nur an José, Werther, Des Grieux, Hoffmann und
natürlich auch Faust. Für deutsche Sänger liegt sicher auch ein
besonderer Reiz darin, die Feinheiten der französischen Klangsprache zu
erfassen und umzusetzen.
Gibt es für Sie – jetzt einmal
unabhängig von jeder stimmlichen Entwicklung – ein Repertoire von dem
Sie sagen: Das würde ich nie machen!
Jonas Kaufmann: Sie meinen,
Stücke, die so schlecht sind, dass ich sie nie singen würde ? Darüber
habe ich noch nicht nachgedacht, und lieber konzentriere ich mich auf
all das, was ich am liebsten noch singen würde. Falls Ihre Frage auf
modernes Repertoire zielt: Ich habe keine Berührungsängste bei
zeitgenössischen Werken, so lange ich
von der Qualität des Stückes
überzeugt bin und den stimmlichen Anforderungen gerecht werde.
Es gibt Sänger, die verordnen sich viele Pausen zwischen den Opern, den
Auftritten. Wie viel Zeit muss für Sie zwischen den Auftritten sein?
Jonas Kaufmann: Das ist je nach Oper sehr unterschiedlich und kommt
auch darauf an, ob es sich um eine Neuproduktion oder um eine
Wiederaufnahme handelt. Leider ist mein Kalender zwischen den Auftritten
mit so viel anderen Dingen gefüllt, dass ich es rot ankreuze, wenn ich
einen wirklich freien Tag habe, ganz ohne Verpflichtungen und
Termine.
Warum üben Sie eigentlich den Job des Sängers aus? Weil
Sie Freude daran haben, weil Sie anderen eine Freude machen? Welcher
Aspekt dieses Berufes ist der Schönste?
Jonas Kaufmann: Teil
eines großen Ganzen zu sein und dennoch als Individuum in Erscheinung zu
treten, in eine Figur hineinzuschlüpfen und mit Gesang und Darstellung
beim Zuschauer Emotionen auszulösen, mit Kollegen, Dirigenten, Chor und
Orchester im Augenblick etwas entstehen zu lassen, das die Zuschauer
berührt und bewegt – das ist ein
einmaliges Gefühl, mit nichts in der
Welt zu vergleichen. Manchmal, wenn alles gut läuft und die Chemie
zwischen allen Beteiligten stimmt, ist es ein ganzes Bouquet von
Glücksgefühlen. Und das möchte man dann beim nächsten Mal wieder
erleben, das ist der Motor der die meisten von uns antreibt.
Viele sehen Oper lediglich als Unterhaltung, die „einen dem üblichen
Trott entheben soll“. Was würden Sie solchen Besuchern sagen?
Jonas Kaufmann: Nichts gegen gute Unterhaltung, im Gegenteil. Natürlich
ist Oper auch Unterhaltung, und natürlich ist es gut, wenn die Zuschauer
für drei, vier Stunden ihren Alltag vergessen und sich in die Zauberwelt
der Oper entführen lassen. Nur finde ich, dass eine gute Vorstellung
weit mehr sein sollte als gepflegte Abendunterhaltung oder ein
Fünf-Gänge-Menü, das man genüsslich konsumiert. Sie sollte den Zuschauer
nicht einlullen, sondern wachrütteln, mitreißen, sensibilisieren, auf
Missstände aufmerksam machen und einem auch die Dinge vor Augen führen,
die man lieber verdrängt. Kurzum: Im besten Fall sollte sich der
Zuschauer nach der Vorstellung anders fühlen als vorher. Nur dann kann
man überhaupt von einem Erlebnis sprechen. Kürzlich sah ich in Berlin
eine grandiose Inszenierung von Patrice Chéreaus. Danach kann man nicht
einfach zur Tagesordnung übergehen, das hallt noch lange in der Seele
nach.
Es gibt Opern, die sind inhaltlich seicht oder weisen
schwer nachvollziehbare Handlungen auf. Würden Sie solche Opern auch
singen?
Jonas Kaufmann: Das habe ich wahrscheinlich schon!! Auch
seichte Stoffe und lächerliche Texte können mit der richtigen Musik zu
großen Kunstwerken werden. Denken Sie nur an all die kruden Libretti in
italienischen Opern, über die man sich seit Generationen lustig macht.
Zum Beispiel Verdis Trovatore: Selbst wenn man die Parodie der Marx
Brothers gesehen hat, verliert Verdis Musik doch nichts von ihrer Größe
und Würde.
Marcel Prawy sagte einmal: Eine gute Oper muss eine
Liebesgeschichte aufweisen. Ist das Verhältnis Faust-Marguerite
überhaupt eine Liebesgeschichte?
Jonas Kaufmann: Es hätte eine
werden können, wenn es eine Beziehung auf gleicher Augenhöhe wäre. Doch
der Erfahrungsunterschied zwischen den beiden ist einfach zu groß, viel
größer als die gesellschaftliche Kluft. Faust hat eben nicht mehr die
Unschuld, die vielleicht zu einer glücklichen Liebe hätte führen können,
und spätestens bei der so genannten Gretchenfrage wird ihm klar, dass
er und sie in unterschiedlichen Welten leben. Sagen wir: Es ist die
Illusion einer Liebesgeschichte, und deshalb hat sie natürlich auch kein
Happy-end.
Oft wird davon gesprochen, was ein Sänger darf, worauf
er achten muss, welche Rollen er wann singen darf, wie sich andere die
Stimme ruiniert haben. Woher weiß man als Sänger, welche dieser
Warnungen wahr sind und welche nicht?
Jonas Kaufmann: Man muss
auf seine innere Stimme hören und gute Ratgeber haben, auf deren Urteil
man vertrauen kann. Und man sollte sich die Zeit nehmen, die Sänger zu
studieren, die sich ihre Qualitäten über 40, 50 Jahre erhalten konnten.
Denken Sie an Domingo, Gedda, Kraus und Bergonzi, an Ludwig, Rysanek,
Scotto, Horne und so viele andere, die Jahrzehnte lang Hauptrollen an
führenden Häusern gesungen haben. Natürlich gibt es für jeden Sänger
Partien, die äußerst riskant sind. Da muss man halt seine Möglichkeiten
kennen, ehrlich zu sich selbst sein und bestimmten Verlockungen
widerstehen, auch den Lobeshymnen in Kritiken.
Sie singen viel
Lied, kann man die interpretatorische Qualität, die man als Liedsänger
mitbringt auch in den Operngesang hineinbringen?
Jonas Kaufmann:
Aber ja, und genauso auch umgekehrt. Eine Opernpartie kann nur gewinnen,
wenn man sie auch mit den Feinheiten des Liedgesangs gestalten kann, und
manche Lieder, z. B. einige von Richard Strauss, profitieren durchaus
davon, wenn man bei bestimmten Phrasen mit der ganzen Kraft des
Opernsängers zulangt.
Als Liedsänger hat man viel Freiheit, als
Opernsänger ist man Regisseuren, Kollegen, Dirigenten etc.
„ausgeliefert“. Wo bleibt auf der Opernbühne da noch Raum für eine
eigene Interpretation?
Jonas Kaufmann: „Ausgeliefert“ würde ich
das nicht nennen. Auch in der Oper gibt es ja einen Prozess, der im
Idealfall am Ende alle zu einem Team formt, in dem jeder dem anderen die
Bälle zuspielt und genauso auch nach vorne stürmt und ein Tor schießt.
Falls Sie auf die Allmacht der Regisseure anspielen: Selbst wenn ich
darstellerisch an die kurze Leine genommen werde, so kann ich doch
innerhalb eines begrenzten Radius noch immer eine kreative Freiheit
ausleben, von der musikalischen Gestaltung gar nicht zu reden.
Verwenden Sie immer neue Klavierauszüge, oder arbeiten Sie immer mit
demselben – der durch diverse Einträge immer bunter wird?
Jonas
Kaufmann: Wenn möglich lasse ich mir von dem entsprechenden Opernhaus
einen eingerichteten Auszug schicken, mit allen Strichen, Änderungen
etc., den ich dann mit meiner Ausgabe abgleiche.
Hat man als
unbekannter Sänger weniger Lampenfieber oder als ein so bekannter wie
Sie?
Jonas Kaufmann: Ich denke, das ist eine Typfrage, und es
hängt auch davon ab, welche Partie man singt und an welchem Haus. Etwas
mehr Adrenalin im Blut zu haben, kann durchaus auch hilfreich sein, aber
man sollte sich nicht allein darauf verlassen. Das beste Mittel gegen
Nervosität ist immer noch eine gute Vorbereitung.
Man braucht
eine Portion Exhibitionismus wenn man Bühnenkünstler sein will. Wie kann
man diesen exhibitionistischen Anteil vom rein künstlerischen
separieren? Gibt es Momente, wo man entscheiden muss: Gib dem Affen
Zucker, oder nein, hier geht es um hehre Kunst?
Jonas Kaufmann:
Die gibt es immer wieder. Beim Schlussterzett Rosenkavalier zum Beispiel
fände ich es grotesk, wenn sich da die drei Frauen den Kampf der
Stimmgiganten liefern würden. Dort gilt’s der Kunst, und je mehr die
drei aufeinander eingehen, desto schöner klingt’s. Und dann gibt’s
wieder Stellen, bei denen das Publikum diese Extra-Portion
„Exhibitionismus“ erwartet, zum Beispiel bei den „Vittoria!“-Rufen in
Tosca. Da macht es mir auch großen Spaß, dem Affen Zucker zu geben, da
bin ich nicht mehr so zurückhaltend wie noch vor vier, fünf Jahren. Nach
meiner ersten Tosca in Wien kam Christa Ludwig zu mir in die Garderobe
und sagte sinngemäß: „Sie singen das alles so fein und kultiviert, aber
als Cavaradossi muss man manchmal auch die Rampensau rauslassen, so wie
der Corelli das gemacht hat.“ Sie hat recht. Wir Mitteleuropäer sind ja,
was die Lust an der Selbstdarstellung betrifft, eher gemäßigt. Uns fällt
es nicht leicht, so ungeniert loszuschmettern wie es die meisten
Italiener und Spanier können. Aber genau das wünscht sich das Publikum,
es will diesen Extra-„Thrill“, diese große Emotion, die man fast
körperlich spürt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Faszinosums
Oper, und wenn ich im Publikum sitze, wünsche ich es mir ganz genauso.