|
|
|
|
|
|
|
|
Neue Osnabrücker Zeitung, 12. Februar 2013 |
|
Ralf Döring |
|
|
|
Neue CDs von Klaus Florian Vogt und Jonas Kaufmann – Wer ist der wahre Wagner-Tenor? |
|
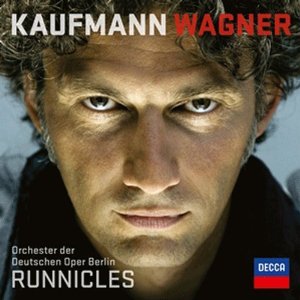
Natürlich werfen sich die beiden wichtigsten Wagner-Tenöre unserer Zeit zum
Wagner-Jahr in Positur: Jonas Kaufmann und Klaus Florian Vogt haben je eine
CD vorgelegt, auf der sie sich durch zentrale Rollen des Bayreuther
Musikgottes singen. Wir stellen beide Aufnahmen vor.
Hier der
Münchner mit Latin-Lover-Flair, dort der holsteinische Recke, hier der
abgründige Tenor mit seinem baritonalen Einschlag, dort die tenorale
Lichtgestalt mit der Tendenz zum Counter: Jonas Kaufmann und Klaus Florian
Vogt symbolisieren physisch wie stimmlich Extrempositionen des
Wagner-Gesangs. Kaum vorstellbar, wie beide ein und dieselbe Rolle
verkörpern – so geschehen beim „Lohengrin“ von Altmeister Hans Neuenfels. In
diesem Vergleich heimste Vogt einen Erfolg ein, dank seiner klaren Diktion,
der sicheren Höhe und der durchsetzungsfähigen Stimme.
Jetzt legen
beide eine Wagner-CD vor, nennen sie schlicht „Kaufmann Wagner“
beziehungsweise „Vogt Wagner“. Dabei bewegt sich Vogt von „Rienzi“ bis
„Parsifal“ und Kaufmann von den Wesendonck-Liedern bis zu den
„Meistersingern“, mit ein paar Überschneidungen für den direkten Vergleich.
Jonathan Nott schubst Vogt gewissermaßen in die „Meistersinger“: Mitten
hinein in ein frühlingshaftes Flirren und Jubeln, als wär’s ein Stück von
Mendelssohn. Dahinein platziert Vogt seine Stimme: Da klingt Wagners Musik
himmelhoch jauchzend wie ein Sonntagsausflug mit der neuen Freundin.
Kaufmann geht anders zur Sache: Er zieht den Hörer ins Herz des Wagner’schen
Schaffens, zu Siegmunds „Schwertmonolog“ aus der „Walküre“. Unter Donald
Runnicles raunt hier das Orchester der Deutschen Oper Berlin, gleichzeitig
entsteht ein feingliedriger musikalischer Raum von der Plastizität einer
Theaterbühne. Da hinein platzt Kaufmann: „Ein Schwert verhieß mir der
Vater“, singt er mit einer Wucht, aus der nicht nur die ganze Not von
Siegmunds Existenz herausklingt, sondern auch eine umwerfende Stimme.
Über ein profundes Fundament verfügte Kaufmanns Tenor ja schon immer;
jetzt klingt er noch fokussierter, die klangliche Basis noch fester im
Bariton-Register verankert. Das verleiht der Stimme einen Ausdruck von
Lebenserfahrung, macht Siegmund geradezu zum Stellvertreter seines Vaters
Wotan auf Erden. Das unterstreichen die beiden „Wälse!“-Rufe: Eine Anrufung
in höchster Not ist das bei Kaufmann, als schmore Siegmund bereits im
Höllenfeuer.
Ganz anders klingt das bei Vogt – auch er hat den
Schwertmonolog ins CD-Programm genommen, auch er sucht nach der Heil
bringenden Waffe, auch er ruft seinen Vater „Wälse“ an. Doch dieser Siegmund
klingt ungleich jugendlicher, forscher, weniger existenziell –naiver?
Während er bei Kaufmann zumindest ahnt, auf dem Altar göttlicher Machtkämpfe
geopfert zu werden, scheint Vogts Siegmund dieses visionäre Wissen
abzugehen.
Darin liegt denn auch der grundsätzliche Unterschied der
beiden Tenöre: Vogt erhält den Rollen ihre Jugendlichkeit oder gibt sie
ihnen zurück. In der dunklen, mächtigen Stimme Kaufmanns grollt hingegen
apokalyptischer Donner. Und selbst wenn er als Stolzing vom „stillen Herd in
Winterszeit“ singt, klingt das, als erzählte ein reifer Mann von seiner
Jugend – während bei dieser Jugendlichkeit im Hier und Jetzt gelebt wird.
Damit nimmt Vogt der Musik Wagners die Anmutung des Erdschweren, tief
Dräuenden. Nein, hier zeigt Wagner seine leichten Seiten, und das mag
durchaus im Sinne des Komponisten sein: Dem ging Textverständlichkeit und
klare Linienführung über alles – und all das finden wir heute bei Klaus
Florian Vogt. Sein „Lohengrin“ ist auch auf dieser CD eine Lichtgestalt,
während sich bei Kaufmanns „Grals-Erzählung“ leichter Nebel um die leisen
Töne legt. Und wenn Vogt das Gebet des Rienzi „Allmächt’ger Vater, blick
herab“ singt, schwingt darin ein naiver Glaube mit, den der Rienzi Kaufmanns
längst verloren hat.
Dabei kommen Nott und die Bamberger Symphoniker
mit Vogt ungleich schneller zum Punkt, verfolgen eher das Ideal eines
klanglichen Realismus als einer romantisierenden Mythologisierung. Runnicles
und das Orchester der Deutschen Oper hingegen kleiden die Gesangspassagen
grundsätzlich großzügiger ein, lassen mehr Opulenz zu und strukturieren
gleichzeitig die Musik mit strenger Präzision. Doch daraus lässt sich
genauso wenig ein Entweder-oder ableiten, wie aus den diametral
entgegengesetzten Stimmen. Beide sind sie ganz bei sich, beide markieren sie
extreme Positionen des Wagnergesangs – und beide lohnen die intensive
Beschäftigung. |
|
|
|
|
|
|