|
|
|
|
|
|
|
|
Merkur, 14.03.2023 |
|
Von: Markus Thiel |
|
|
|
Antonio Pappanos „Turandot“-Einspielung: Pizza Puccini mit allem |
|
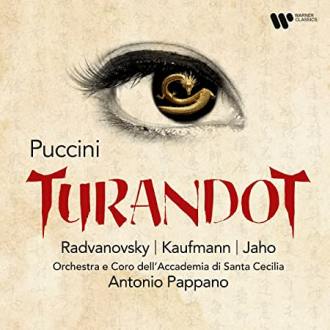
Eine Gesamtaufnahme unter Studio-Bedingungen: Diese „Turandot“ ist irgendwie
aus der Zeit gefallen. Antonio Pappano vertraut auf Jonas Kaufmann als
Calaf, ein langes Finale und kleine Überraschungen.
Gut 50 Minuten
hat das blutige Märchen schon gedauert, da kommt es zur Pointe. Der greise
chinesische Kaiser Altoum trifft auf Calaf, der die Tochter des Monarchen
begehrt. Erstere Partie, eine Mini-Aufgabe, wird hier gesungen von Michael
Spyres, dem zurzeit spannendsten, vielfältigsten, zwischen Rossini und
Wagner hochversiert tänzelnden Tenor, ein Cameo-Auftritt. In der anderen
Rolle ist Jonas Kaufmann aktiv, Werbeträger dieser Neueinspielung. Zwei
Stil- und Vokal-Welten prallen aufeinander, als ob man Shakespeares „Hamlet“
mit Arnold Schwarzenegger als Titelheld besetzt und für den Polonius Joachim
Meyerhoff holt.
Wer Spyres für den Altoum engagiert, muss also Geld
haben. Überhaupt ist diese Aufnahme von Giacomo Puccinis „Turandot“ etwas,
das es eigentlich gar nicht mehr gibt. Opernstars für mehrere Tage vor
Studiomikrofone zu holen plus eine anschließende konzertante Aufführung als
i-Tüpferl, das lässt sich kaum mehr finanzieren. Anders als vor einem halben
Jahrhundert, als es der Plattenindustrie gut ging und sie fast monatlich
eine Opern-Einspielung ausstieß.
Insofern ist diese gerade
erschienene Box aus der Zeit gefallen. Und deshalb wichtiger denn je.
Antonio Pappano, scheidender Chefdirigent der römischen Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, hat so etwas in den vergangenen Jahren schon häufiger
praktiziert, meist mit Kaufmann als Zugpferd. Im Falle der „Turandot“, die
der krebskranke Puccini bekanntlich nicht mehr vollenden konnte, wartet
Pappano mit einer Besonderheit auf. Zu hören ist das von Franco Alfano
komplettierte Finale, das sonst – wenn überhaupt – in einer Kurzversion
erklingt.
Zu hören gibt es Franco Alfanos kompletten nachkomponierten
Schluss
Wie eine eiskalte Prinzessin innerhalb weniger Minuten für einen
Freier entflammt, den sie gerade noch köpfen wollte, diese dramaturgische
Nuss konnte Puccini nicht mehr knacken. Toscanini ließ das Opus 1926 bei der
Uraufführung mit dem Suizid der in Calaf unsterblich verliebten Liù enden,
ein offener Schluss, den Opernhäuser heute wieder häufiger praktizieren.
Oder sie lassen sich von Zeitgenossen wie Luciano Berio eine Lösung
schreiben. Die klassische Alfano-Kurzvariante wirkt dagegen wie angeklebt,
das zur Chorversion aufgedonnerte „Nessun dorma“ dient hier als billiger
Applauskitzler.
Bei Pappano lauscht man der langen Variante, ist zwar
von dieser Pizza Puccini mit allem dramaturgisch befriedigt, zumal leise,
vorher nicht gehörte intime Momente zwischen Turandot und Calaf passieren.
Wenn aber alles zur triumphalen Liebesbrunst anhebt, fummelt man sofort am
Dynamikregler – man will ja bei den Nachbarn nicht auffallen. Ansonsten
bedient Pappano, er ist das Ereignis dieser Aufnahme, gerade nicht die
„Turandot“-Klischees. Puccinis opulenteste Oper stampft einen nicht nieder
mit Effekten. Dafür gibt es fein Ausgehörtes, ein rundes, farbsattes,
substanzreiches Klangbild, in dem nicht die Rhythmusinstrumente, sondern die
Streicher eine entscheidende Rolle spielen. Das Orchester vermittelt das mit
Eleganz und Wärme, der Chor hat nur Schaum vor dem Mund, wo es wirklich
nötig ist.
Auch Sondra Radvanovsky gibt in der Titelrolle nicht die
Stahlarbeiterin. Für Extremlagen hat die ehemalige Belcanto-Expertin genug
Power. Doch auch bei solchen Grenzgängen bleibt ihr Sopran gerundet und der
Text verständlich – an das eher eigentümliche Timbre gewöhnt man sich
schnell. Ermonela Jaho als Liù irritiert durch leichtes Flirren, dafür
gibt’s in Höhenlagen Flötenzaubertöne. Mattia Olivieri, Gregory Bonfatti und
Siyabonga Maqungo begreifen die drei Minister als das, was sie sein sollten:
keine Buffo-Gestalten, sondern ein böses, zynisches Trio.
Und Jonas
Kaufmann? Der gibt wie immer den Malocher im Bergwerk des dunklen
Tenorklangs. Zum Calaf passen seine Tenor-Muskelspiele. Für Lyrismen kann er
sein Organ trotzdem herunterpegeln und zärteln lassen. Dass manches am
Anschlag ist, könnte gewollt sein und unter Dramatik verbucht werden. Eine
Interpretation aus guter alter Opernzeit, man höre dazu nicht nur die
überlang (und partiturwidrig) ausgehaltene Fermate im „Nessun dorma“ auf
„Vincero!“ Eine Todsünde allerdings, dass Pappano (zumindest in der
Stream-Version) dem Divo den Konzertschluss der Arie gönnt – Puccini ließ
die Nummer ganz bewusst in das darauf folgende Ensemble übergehen. Das
Rattern des rotierenden Komponisten-Leichnams dürfte nicht nur Torre del
Lago aufschrecken.
|
|
|
|
|
|
|