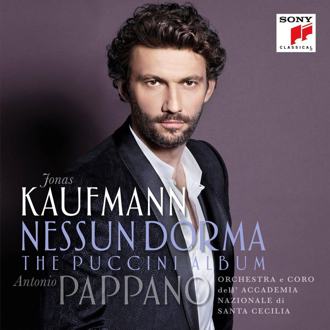
Im deutschen Repertoire hat sich Jonas Kaufmann längst seine Meriten
verdient, in der Oper wie im Lied. Auch seine französischen
Steher-Qualitäten hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, etwa als
Werther wie „Carmen“-Don José, im Dezember singt er neuerlich in Paris
szenisch „La damnation de Faust“ von Berlioz, und auch der Offenbach-
Hoffmann ist in Planung. Doch vorher gab es in München, nach wie vor
gegenwärtig so etwas wie sein Stammhaus, den ersten Radames (dem im Mai
dort dann das szenische Debüt als Walter von Stolzing in Wagners
„Meistersinger“ folgt). Und auch sonst ist sein Herbst ein italienischer
– er wird Giacomo Puccini gewidmet sein.
Denn auch wenn der
gegenwärtig meistgefragte und erfolgreichste Tenor der Welt – zudem
endlich wieder ein Klassikkünstler, der auch das Zeug zum Popstar hat –
in den letzten Jahre dieses Repertoire zielstrebig ausgebaut hat
(„Madama Butterfly“ auf CD, vielleicht auch mal szenisch, mit
Rollendebüts als Dick Johnson/„La fanciulla del west“ und Des
Grieux/„Manon“ in Wien und London) – so eine ganze CD wildert dann
natürlich schon sehr deutlich im Domingo- und Pavarotti-Terrain. Mit
ersterem hat er die dunkel abgetönte virile Stimme gemein, doch erreicht
er die Spitzentöne leichter; von Pavarotti hat er sich die Delikatesse
und Leichtigkeit der Aufschwünge gut gemerkt.
„Ich kümmere mich
nicht um mein sexy Image“, versucht Kaufmann einem glaubhaft zu
versichern. Stimmt natürlich nicht. Sexy sind nach wie vor die Locken,
die dunklen Augen, der im wahren Tenorleben (jenseits schöngefärbter
Cover) schon interessant graue Dreitagebart. Der gut klingende Junge
will jetzt reif erscheinen, aber zugleich mit seinen vokalen
Möglichkeiten verführen. Eigentlich folgerichtig, dass er das nach dem
höchst verkaufsträchtigen Operetten- und Rundfunkschlager- Album samt
Tournee „Du bist die Welt für mich“ nun mit „Nessun dorma – The Puccini-
Album“ fortsetzt.
„Butterfly“ und schnelle Autos
Der 1924
an Kehlkopfkrebs gestorbene Italiener ist nicht nur letzter
Repertoirekönig der italienischen Oper, sondern auch der ideale
Komponist für das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. „Puccini
hat es verstanden, wirkliche, eindeutige und doch sehr individuelle
‚Schlager’ zu schreiben“, findet Kaufmann. „Eine späte Puccini-Arie ist
wie eine Hit-Melodie heute, ganz bewusst auf kurze Spielzeit und einen
nicht zu langen Aufmerksamkeitsmoment konzipiert. Das ist sehr
zeitgenössisch, so wie Puccini ja generell ein moderner Künstler war.
Einer, der sich für damalige Erfolgsstücke wie Belascos ‚Butterfly‘ oder
‚The Girl From The Golden West‘ interessierte, für Schönberg und
Strawinski, für schnelle Autos und Grammophone. Das kulminiert dann
alles in ‚Turandot‘. Puccini ist der letzte Volkskomponist geworden,
aber mit Anspruch. Man darf es sich mit ihm nicht zu leicht machen.“
Und leicht macht es sich Jonas Kaufmann in der Tat nicht. Er findet
trotzdem in diesen 16 CD-Nummern die richtige Mischung aus Präzision und
Loslassen, Genuss und Arbeit, pädagogischem Eros und Fanbeglückung.
Zumal er gleich zu Anfang mit vier Exzerpten aus „Manon Lescaut“ dem
gern unterschätzen, vor allem für den Tenor schweren Frühwerk („davor
habe ich allergrößten Respekt“, gibt er zu) einen bedeutenden und
prominenten Hörplatz einräumt. Da ist zudem, wie auf dem gleichzeitig
erscheinenden Opern-DVD-Mitschnitt, Kristine Opolais seine dramatisch
zupackende Partnerin, und Kaufmann führt den Puccini-Tenor nicht als
isoliertes Arien-Alien vor, sondern blüht auf im Geben und Nehmen mit
der Sopranpartnerin.
Die Ausschnitte aus „La Bohème“, „Tosca“,
„Butterfly“, „La Rondine“ (ein früher Durchbruch für ihn in London, 2004
an der Seite Angela Gheorghius) und auch „Turandot“ (der Calaf wartet
noch auf eine – schon angedachte – Bühnenverwirklichung, so wie
eventuell der Pinkerton), die sind für ihn natürlich Tenor-Routine auf
allerhöchstem Niveau, ein Sich-Messen mit illustren Rollenvorgängern und
würdiges Einreihen in der Porträtgalerie. Der glutvolle, sinistre Luigi
im „Tabarro“ ergänzt diese Figuren, während für den Rinuccio im „Gianni
Schicchi“ mit seiner ariosen Florenz-Liebeserklärung die Stimme
natürlich längst zu schwer geworden ist. Aber ein wenig vokale
Verkleidung schafft ein Kaufmann mit links. Besonderen Wert legt der
Sänger freilich auf die beiden Arien aus den Frühwerken „Le Villi“ und
„Edgar“: Die sind wie ein Experimentierkasten. Puccini ist schon
deutlich erkennbar, aber die Soli sind schwerer, länger und viel
komplexer. Er will hier alles zeigen, was er kann.
Sehr wichtig
scheint für Jonas Kaufmann, und man hofft, dass er die Rolle noch länger
im Repertoire halten wird, der Dick Johnson im „Mädchen aus dem goldenen
Westen“. Kein Strahlemann, ein geläuterter Verbrecher, der um seine
Minnie kämpft, die ihn freilich am Ende vom schon wartenden Strick
schneiden muss. Das sind beides keine jungen Leute mehr, die haben ihre
Lebenserfahrungen gemacht. Und sich für einander entschieden. Das hört
und sieht man wunderbar auch in der gerade herauskommenden DVD mit Nina
Stemme von den Wiener Aufführungen im Herbst 2013 unter Franz
Welser-Möst.
Nicht nur Puccini, auch Verdi wird natürlich durch
einen kompetenten Dirigenten und ein erstklassigen Orchester veredelt.
Und so kontrastiert Jonas Kaufmann seinen Puccini-Herbst mit einem
luxuriösen Verdi-Juwel, der römischen Studioproduktion der „Aida“, die
dort mit einer gefeierten konzertanten Aufführung im Februar beendet
wurde. Bei beiden Produktionen standen ihm die gleichen, guten Begleiter
zur Seite. Chor und Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia
sind zwar mit dem Idiom vertraut, spielen als Konzertklangkörper
freilich gar nicht so viel Opernmusik. Also gibt es viel Enthusiasmus
und gar keine Routineschleifer, alle lassen sich von ihrem geschätzten
Chefdirigenten Antonio Pappano zu dieser süffigen Musik (ver-)führen,
nehmen sie aber nicht (zu) leicht.
Pappanos Ägypten: Römischer
Luxus
Pappano betont das Impressionistische, die Zartheit dieser
ägyptischen Fantasiemusik, die eben doch durch und durch italienisch
ist, tupft Stimmungszauber am nächtlichen Nil, kann aber natürlich auch
einen schlankstrahlenden Triumph-Akt. Und er hat ein feines Ensemble an
seiner Seite, das sich vor illustren Vorgängern nicht verstecken muss.
Kaufmann ist ein sensibler, intelligenter Radames wie kaum einer vor
ihm, mit mustergültigem Diminuendo auf dem hohen B in „Celeste Aida“,
mit Schmelz und Volumen. Anja Harteros, nach wie vor nicht die ideale
Plattenstimme, aber ihm bestens vertraute Partnerin, ist von
durchscheinender Fragilität, tut sich mit den Höhen etwas schwer. Sonor,
aber nicht brustig klingt Ekaterina Semenchuk als Amneris. Mit dem
geschmackvoll-markigen Ludovic Tézier (Amonasro) ist der gegenwärtig
beste Verdi-Bariton in der Besetzungsbarke, und auch Erwin Schrott
(Ramfis) und Marco Spotti (König) lassen ihre tiefen Töne leuchten. So
ist das die beste (ebenfalls bei Warner Classics) im Katalog stehende
„Aida“ seit der von Riccardo Muti geworden.
Und Jonas Kaufmann
ist somit weiter auf der Überholspur: „Ich genieße es. Je mehr man sich
einbringt, desto mehr bekommt man zurück, aber man darf nicht vergessen,
dass man seine Batterien aufladen muss.“
|