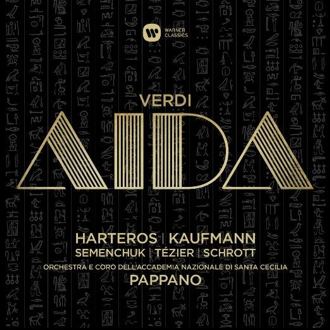
Er sei ja ein guter und intelligenter Sänger. Aber ohne sein Aussehen
würde Jonas Kaufmann noch immer im Staatstheater Saarbrücken singen. Das
sagen die Verächter des Münchners. Und ein wirklich italienischer Sänger
sei er auch nicht.
Verzeihung, Einspruch. Es ist nicht purer
Lokalpatriotismus, wenn Kaufmann hier nach jedem Auftritt und für jede
seiner Platten hymnisch gelobt wird. Dieser Sänger steht im Zenith
seines Könnens. Und das lässt sich überprüfen, wenn man erst seinen
Bühnen-Radamès im Nationaltheater hört und dann die neue Gesamtaufnahme
von Verdis „Aida“ unter Antonio Pappano.
Kaufmann ist im
Opernhaus so perfekt wie auf der Platte. Er hat die Nerven, das hohe B
in der Romanze „Celeste Aida“ auch auf der Bühne wie notiert im
Pianissimo zu singen. Denn es ist viel leichter, den Spitzenton laut zu
trompeten und dafür billigen Applaus einzuheimsen.
Der komplette
Radamès und eine ideale Aida
Und ist auch nicht so, dass das Auge
mithören würde. Was der Darsteller Kaufmann spielt, kann der Sänger auf
einer Platte auch ohne Bühne musikalisch gestalten. Auch auf CD ist der
46-Jährige ein kompletter Radamès, der Lyrismen und heldische Töne je
nach dramatischer Situation vereint.
Pappanos Gesamtaufnahme hat
auch eine ideale Aida: Anja Harteros. Seit Montserrat Caballè und Katia
Ricciarelli wird die Titelpartie der Oper eher lyrisch besetzt. Darüber
lässt sich eine Grundsatzdebatte führen. Sie muss allerdings verstummen,
wenn die Rolle mit einer solchen Gestaltungskraft interpretiert wird.
Die Kunst der Zurücknahme, mit der Anja Harteros singt, ist eine
eindringliche Deutung dieser Figur als zarte, zerbrechliche Frau. Und
wer die Oper schon öfter gehört hat, der weiß, wie schwer es ist, aus
diesen Figuren Menschen zu machen.
Leider gibt es derzeit
offenbar keine Amneris, die zu dieser Aida passt. Im Terzett des ersten
Akts antwortet Ekaterina Semenchuk auf die von Anja Harteros musikalisch
gestaltete Angst nur mit Sonorität. Der Amonasro ist mit Ludovic Tézier
zu lyrisch besetzt. Wenn das Orchester im Triumph-Akt beredt von seiner
Niederlage erzählt, bleibt der Sänger blass. Auch im Duett mit Aida
wirkt er nicht wirklich gefährlich. Die beiden Bass-Rollen werden
ordentlich gesungen, aber es ist nicht einfach, den König von Marco
Sprotti und den rauen Ramphis von Erwin Schrott auseinanderzuhalten.
Großartiges Orchester
Die wahre Primadonna dieser Aufnahme ist,
trotz Harteros und Kaufmann, das Orchester: die Accademia Nazionale di
Santa Cecilia aus Rom. Das einzige international konkurrenzfähige
Symphonieorchester Italiens prunkt mit seidigen Streicherklang und schön
singenden Bläsern. Es spielt warm und strahlend zugleich. Die
Bühnenmusik, ein Polizeiorchester, schmettert den Triumphmarsch nicht,
sondern interpretiert ihn mit Belcanto. Wer hätte gedacht, dass selbst
da Zwischentöne möglich wären?
Der italienische Brite und
britische Italiener Antonio Pappano schafft es, Kammerspiel und
Staatstheater zu versöhnen. Er hat ein gutes Gespür für frische Tempi,
er zeigt nichts demonstrativ vor und hascht auch nicht nach Effekten.
Ein paarmal hat man allerdings den Eindruck, als sei die Lautstärke des
Orchesters künstlich nachgeregelt worden. Und der fast unhörbare Chor am
Anfang des dritten Akts wirkt auch ein wenig affig. Aber das mag daran
liegen, dass das Ohr mittlerweile auf die selten gewordenen
Studio-Produktionen von Opern empfindlicher reagiert.
Und wie
schon bei Pappanos Verdi-„Requiem“ gilt: Es ist die beste Aufnahme seit
Jahren. Echt schade, dass Pappano sich in München so rar macht.
|