|
|
|
|
|
|
|
| Tages-Anzeiger, 30.03.2009 |
| Susanne Kübler |
Puccini: Tosca, Zürich, 29. März 2009
|
Die Kirche wird zum Theater – und Toscas Liebe auch
|
| Das Zürcher Opernhaus zeigt eine szenisch und
sängerisch ungewohnte «Tosca». Dem Publikum hats gefallen. |
|
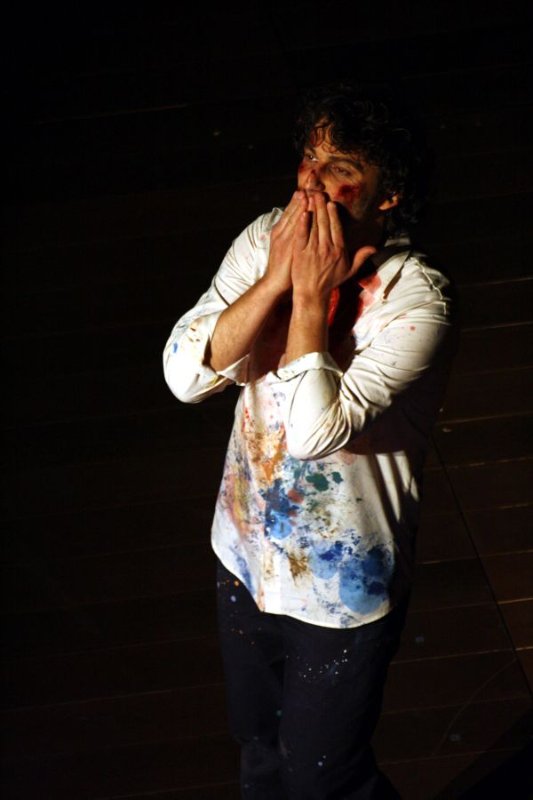 Puccinis
«Tosca» ist ein harter Brocken für fantasievolle Regisseure. Kaum eine
andere Oper legt so vieles so genau fest, und zwar nicht nur in den
Regieanweisungen im Libretto, die man notfalls auch überlesen könnte. Auch
nicht nur im Text, der ebenfalls längst nicht mehr heilig sein muss. Puccini
ging weiter und definierte die Orte der Handlung in seiner Musik. In der
Kirche Sant Andrea della Valle etwa wird nicht nur gemalt, geliebt,
gestritten und verleumdet, es läuten auch die Kirchenglocken, und der Chor
singt ein «Te Deum» – darüber kann ein Regisseur schlecht hinweghören. Puccinis
«Tosca» ist ein harter Brocken für fantasievolle Regisseure. Kaum eine
andere Oper legt so vieles so genau fest, und zwar nicht nur in den
Regieanweisungen im Libretto, die man notfalls auch überlesen könnte. Auch
nicht nur im Text, der ebenfalls längst nicht mehr heilig sein muss. Puccini
ging weiter und definierte die Orte der Handlung in seiner Musik. In der
Kirche Sant Andrea della Valle etwa wird nicht nur gemalt, geliebt,
gestritten und verleumdet, es läuten auch die Kirchenglocken, und der Chor
singt ein «Te Deum» – darüber kann ein Regisseur schlecht hinweghören.
Robert Carsen, der dem Zürcher Publikum spätestens seit seiner ebenso
witzigen wie klugen (und mittlerweile auf DVD erhältlichen) Inszenierung von
Händels «Semele» ein Begriff ist, versucht es trotzdem. Bei ihm wird die
Kirche zum Theater – schliesslich ist die Tosca eine berühmte Sängerin.
Scarpias Gemächer und die Engelsburg verlegt der Kanadier ebenfalls in
dieses Theater, ohne dass er deshalb die Handlung als Theater zeigen würde:
Der böse Scarpia foltert Toscas Geliebten Cavaradossi sehr blutig, Tosca
bringt ihren Peiniger tatsächlich um, und auch die Erschiessung des
Cavaradossi findet zwar auf der Bühne statt, aber sie ist echt.
Wer ist Scarpia?
Geht das auf? Nicht, wenn man Carsens Inszenierung im Sinn von Puccinis
Realismus versteht. Dann ist die Uminterpretation ziemlich fragwürdig: Wer
soll dieser Maler Cavaradossi sein (ein Bühnenbildner?), und wie kommt es,
dass er im Theater heimlich eine betende Frau porträtieren kann? Warum singt
das Theaterpublikum ein «Te Deum»? Und wer ist Scarpia? Selbst die
tyrannischsten Theaterdirektoren verzichten in der Regel auf die Mittel
Folter, Erpressung, Vergewaltigung und Mord, und selten geraten sie derart
unter Druck bei der Meldung, dass der politische Wind gedreht habe. Am Ende
von Akt eins, wenn sich der Theatervorhang öffnet auf ein jeden
barock-kirchlichen Prunk noch überprunkendes Marienbild, ist man versucht,
Carsens Idee und die Kunst seines Ausstatters Anthony Ward als ästhetisch
grandios, aber sinnlos abzuhaken.
Aus Toscas Sicht
Ganz anders – und weit überzeugender – wirkt die Inszenierung allerdings,
wenn man sie als subjektive Sicht der Tosca versteht. Dann ist Cavaradossi
natürlich ein Maler in der Kirche Sant Andrea della Valle (man hört es ja),
und Scarpia bleibt der römische Polizeichef. Aber Tosca, die Sängerin, lebt
ihr Theaterleben in der Realität weiter, die sie ziemlich verschoben zur
Kenntnis nimmt. Alles wird bei ihr zum Auftritt, und Emily Magee zelebriert
das genüsslich: Wie Trophäen trägt sie ihre diversen Blumensträusse, vor dem
Gespräch mit Scarpia züpfelt sie hingebungsvoll ihre Handschuhe zurecht, und
sie geht mimisch aufs Ganze, wenn es darum geht, ihre Gefühlslagen klar zu
machen. Schliesslich hat sie die Liebe, die Eifersucht, die
Heldinnenhaftigkeit schon tausendfach in ihren Rollen dargestellt, und Magee
betont das mit einer etwas gläsernen, eher kunstvollen als warmen Stimme –
Toscas Bühnenstimme eben.
Das passt durchaus zum Werk. Schliesslich ähnelt auch der Mord an Scarpia
vielen anderen Opernmorden («erstickst du an deinem Blut?», fragt Tosca
immer wieder in einer typischen Librettoformulierung). Und so richtig in
ihrem Element ist sie, wenn sie Cavaradossi erklärt, wie er unter den
Scheinschüssen zusammenzubrechen habe; fast bedauert sie, nicht selber an
seiner Stelle zu stehen, und als er dann tatsächlich perfekt fällt, ist sie
stolz auf ihren «Künstler».
Auch das Zürcher Opernpublikum spielt seine Rolle in dieser Sicht auf die
Geschichte. «Vissi d`arte» singt Tosca, auf den letzten Ton folgt tosender
Beifall, in den nach einer Weile auch Scarpia einfällt. So ist es nur
logisch, dass sich zuletzt, nach Toscas Todessprung (nicht aus der
Engelsburg, sondern von der Bühne) der Vorhang noch einmal öffnet: Da steht
sie wieder, gesund und munter, und erhält zwei Blumensträusse von Scarpias
Dienern. Applaus, Applaus.
Tosca also lebt weiter, der Tod ihres Geliebten Cavaradossi hält sie
nicht davon ab. Damit erscheint nun aber dieser Cavaradossi plötzlich nicht
mehr nur als Opfer des Scarpia, sondern auch einer Tosca, die seiner tiefen
Liebe eine theatralische gegenüberstellt. Er wird zum alleinigen
Sympathieträger dieser Aufführung, und Jonas Kaufmann tut sich nicht schwer
mit dieser Aufgabe. Sein Cavaradossi ist zutiefst menschlich, in seinen
Gefühlen und politischen Überzeugungen gleichermassen leidenschaftlich,
aussergewöhnlich leise auch. Nur schon sein «E lucevan le stelle» lohnt den
Besuch der Aufführung: Wie sehr ist einem dieser tenoral überhitzte Hit
verleidet – und wie berührend ist er, wenn ein Sänger darin Nachdenklichkeit
und gewaltsam abgeklemmte Lebenslust, Trauer und Liebe zu vermitteln weiss.
So ist an diesem Abend nichts zu hören vom dauer-brünstigen Liebhaber der
meisten «Tosca»-Aufführungen. Und auch der dritte Protagonist, Scarpia, ist
mit Thomas Hampson untypisch besetzt. Hampsons Bariton ist weit weniger
schwarz, als man es sonst von diesem Bösewicht gewohnt ist; daran ändert
auch sein geradezu mephistophelischer erster Auftritt zwischen den
Theatersäulen nichts. So sehr er sich im zweiten Akt um sadistische,
egomanische, lüsterne Töne bemüht: Es bleibt (gekonntes) Theater, auch bei
ihm.
Dirigenten-Turbulenzen
Und das Orchester? Es spielt erstaunlich kompakt für die turbulente
Vorgeschichte dieser Aufführung. Christoph von Dohnányi, der das Dirigat im
Januar von Michael Tilson Thomas übernommen hatte und noch im
«Opernhaus-Magazin» vom «riesigen Spass» an diesem Werk schwärmt, hat sich
vier Tage vor der Premiere verabschiedet. Eingesprungen ist mit Paolo
Carignani ein Kenner und Routinier der italienischen Oper, dem es nicht
darum gehen konnte, noch rasch eine neue Sichtweise zu entwickeln (das wird
sich im Folgenden kaum ändern: Carignani übernimmt nur einen Teil der
Abende, den Rest besorgt Carlo Rizzi).
Feststellen lässt sich, dass einzelne Passagen bei der Premiere zu laut
gerieten – obwohl der notorische Lautspieler Dohnányi betont hatte, dass es
hier um Durchsichtigkeit, nicht um eine «durchgestemmte» Geschichte gehe.
Feststellen lässt sich aber auch, dass die Sänger insgesamt präzis, kantabel
und aufmerksam begleitet wurden. Mehr lässt sich unter diesen Bedingungen
nicht erwarten. Und es genügt, um das Bild einer sehr bemerkenswerten
«Tosca» abzurunden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|